Der Europäische Aal
Stibt dieser MeeresBürger bald aus?
Sie kennen den Aal. Die meisten von uns in einem Brötchen.
Der schlangenähnliche Fisch lebt in unserern Gewässern und wird von vielen als kulinarische Spätzialität geliebt. Doch es steht schlecht um diesen Meeresbürger und Weltenbummler. Erfahren Sie auf diesen Seiten mehr über seine Lebensweise, seine Besonderheiten, die Gefahren und was getan werden kann, um diesem Fisch hilfreich "unter die Flossen zu greifen".
Der Aal – Ein Flossentier auf Wanderschaft
Alle Europäischen Aale schlüpfen in den Tiefen und Weiten des südlichen Nordatlantiks aus dem Ei – irgendwo in der Sargassosee (siehe Graphik Punkt 1), einem Seegebiet, das größer als Mitteleuropa ist. Hier sterben auch all die Tiere, die...
Alle Europäischen Aale schlüpfen in den Tiefen und Weiten des südlichen Nordatlantiks aus dem Ei – irgendwo in der Sargassosee (siehe Graphik Punkt 1), einem Seegebiet, das größer als Mitteleuropa ist. Hier sterben auch all die Tiere, die es schaffen zum Laichen wieder zurückzukehren.
Die Route der Aallarven (Weidenblattlarve) aus dem Laichgebiet und ihre Verdriftung mit dem Nordatlantikstrom an Europas Küsten (siehe Graphik Punkt 2), konnte durch mehrere Untersuchungen in den letzten hundert Jahren stückweise rekonstruiert werden. Dieser Reiseabschnitt von rund 5.000 km kann bis zu 3 Jahren dauern.
Rund 100 km vor der europäischen Küste beginnt die Metamorphose der Weidenblattlarve zum Glasaal.
Die Glasaale verteilen sich dann über die europäischen Gewässer. Ein Teil der Tiere bleibt in den Küstengebieten und Flussmündunge (siehe Graphik Punkt 3), während ein anderer Teil in die Flüsse und Seen weiterzieht (siehe Graphik Punkt 4). Die Aale verändern nun wiederum ihr Aussehen. Aus den Glasaalen werden die Steig- oder Gelbaale.
Die meiste Zeit ihres Lebens verbringen sie dann dort. Nach 20 bis 50 Jahren beginnt dann erneut eine Metamorphose. Nun gehen die Tiere als Blank- oder Silberaal auf die lange Reise zurück zur Sargassosee (siehe Graphik Punkt 5). Auch hier nutzen sie im Atlantik wieder Strömungen um energiesparend ans weit entfernte Ziel zu kommen. So jedenfalls sähe der normale Lebenszyklus der Europäischen Aale aus.
Jedoch sind die Aale während ihres Lebens vielen unterschiedlichen Gefahren ausgesetzt. Die Larven werden von anderen Fischen gefressen, die Glas- und Silberaale landen auf Tellern und werden von uns Menschen verputzt. Der Verbau der Landschaft, Turbinen und Umweltgifte machen es den Tieren nicht leicht zu überleben.

Die Entwicklungsstadien
Der Aal kann in freier Natur zwischen 20 und 50 Jahre alt werden. Wähend dieses langen Lebens durchläuft er vier verschiedene Entwicklungsstadien.
Der Lebenszyklus des Aals ist besonders interessant, weil er sich zu Beginn und zum Ende...
Der Aal kann in freier Natur zwischen 20 und 50 Jahre alt werden. Wähend dieses langen Lebens durchläuft er vier verschiedene Entwicklungsstadien.
Der Lebenszyklus des Aals ist besonders interessant, weil er sich zu Beginn und zum Ende seines Lebens auf eine Reise von über 5.000 km begibt.
Jeder Aal kann nur einmal in seinem Leben Nachwuchs zeugen. Jeder Aal, der also vor dem Ablaichen getötet wird - sei es auf natürlichem Wege durch Fressfeinde, durch Krankheiten, technische Hindernisse oder für den Verzehr des Menschen - hat nie Nachkommen produziert.
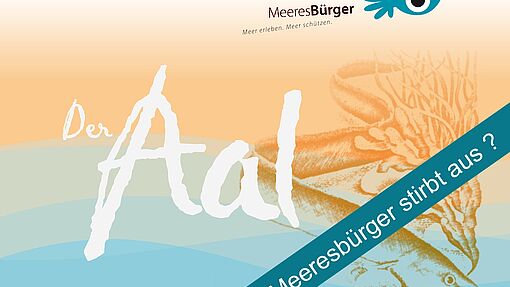
Die Weidenblattlarve
In den Tiefen der Sargassosee paaren sich die Aale. Darüber ist heute noch sehr wenig bekannt. Man vermutet, dass die Aalweibchen in einer Tiefe von ca. 500 Metern bei einer Wassertemperatur von ca. 17°C ihre 1-1,5 Millionen Eier ins...
In den Tiefen der Sargassosee paaren sich die Aale. Darüber ist heute noch sehr wenig bekannt. Man vermutet, dass die Aalweibchen in einer Tiefe von ca. 500 Metern bei einer Wassertemperatur von ca. 17°C ihre 1-1,5 Millionen Eier ins freie Wasser abgeben und die Männchen daraufhin ihre Samen abstoßen. Möglicherweise verhindert ein kleiner Öltropfen im Gewebe das Absinken der Eier auf den 6.000 Meter tiefen Meeresgrund.
Aus den Eiern schlüpfen kleine, ca. 4 bis 5 mm große Larven. Damit sie ihre Reise zum anderen Ende des Ozeans auch mühelos überstehen, wandeln sich die runden Körper und nehmen eine weidenblattähnlichen flachen Form.
Die sogenannte Weidenblattlarve kann sich so mit den Meeresströmungen treiben lassen und legt in rund 3 Jahren ungefähr 5.000 km zurück. Tagsüber treiben sie in ca. 200 bis 300 Metern Tiefe, nachts können sie bis auf 25 Meter aufsteigen.
Etwa 100 km vor der europäischen Küste beginnt die Metamorphose der Weidenblattlarve zum Glasaal.

Der Glasaal
Wenn die Metamorphose von der Weidenblattlarve hin zum Glasaal einsetzt, dann verändert sich der Körper nicht nur in der Form. Auch die spitzen Larvenzähne werden durch bleibende Zähne ersetzt. Ebenfalls wird das gesamte Verdauungssystem...
Wenn die Metamorphose von der Weidenblattlarve hin zum Glasaal einsetzt, dann verändert sich der Körper nicht nur in der Form. Auch die spitzen Larvenzähne werden durch bleibende Zähne ersetzt. Ebenfalls wird das gesamte Verdauungssystem umgewandelt. In dieser Umwandlungsphase können die Tiere nicht fressen und verlieren kurzzeitig an Gewicht und Größe. Sobald sie die Küsten erreichen, beginnt für viele Tiere der Aufstieg in die Flüsse und Seen, die ihre neue Heimat darstellen werden. Zu diesem Zeitpunkt werden sie dann als Steig- oder Gelbaal bezeichnet.
Glasaale sind begehrt bei Anglern, Fischern und Feinschmeckern. Sie dienen als Besatz für Seen, in die die Aale nicht mehr aufsteigen können, und für die Aquazucht. Leider landen immer noch viel zu viele dieser kleinen Tiere in großem Maße auf "unserem" Teller.

Der Steig- oder Gelbaal
Die männlichen Aale verbleiben meist in den Flussmündungen und Küstenstreifen. Die weiblichen Tiere werden zu Binnenaalen. Sie steigen in riesigen Schwärmen die Flüsse hinauf in die Seen. In dieser Zeit werden sie Steigaal genannt. Dieser...
Die männlichen Aale verbleiben meist in den Flussmündungen und Küstenstreifen. Die weiblichen Tiere werden zu Binnenaalen. Sie steigen in riesigen Schwärmen die Flüsse hinauf in die Seen. In dieser Zeit werden sie Steigaal genannt. Dieser Aalaufstieg kann mehrere Jahre dauern.
Bei der Wanderung können die Tiere täglich bis zu 25 % ihres Körpergewichtes fressen. Ihr Körper beginnt sich nach und nach gelblichbraun zu färben. Daher werden diese Aale dann auch Gelbaal genannt. Die Gelbaale fressen jetzt soviel wie möglich. Die weiblichen Tiere wachsen bis auf eine Größe von 50 - 100 cm heran. Die Männchen werden maximal 45 cm lang.
Bei ihrer Wanderung haben sie oft Hindernisse zu überwinden. Durch die Fähigkeit, Sauerstoff über die Haut aufnehmen zu können, ist es den Aalen möglich längere Strecken auch über Land zu schlängeln. Leider sind die Gewässer heutzutag voll von Hindernissen, denen ein Aal nicht so einfach ausweichen kann.
Der Kopf ist je nach Ernährungsweise entweder spitz (Allesfressertyp) oder breit (Raubfischtyp). Alle unpaaren Flossen bilden in ihrer Gesamtheit einen Flossensaum. Dem mit sehr kleinen Schuppen bedeckten Aalkörper fehlen die Bauchflossen. Die dunkelgraue bis dunkelbraune Rückenfarbe steht in deutlichem Kontrast zum Gelb des Bauches (Gelbaal), der sich beim abwandernden Aal in ein silbriges Weiß verwandelt (Blankaal).

Der Blank- oder Silberaal
Wenn die innere Uhr des Aals ihn zurück in sein Geburtsgewässer zieht, dann beginnt die nächste Metamorphose. Er wird vom Gelbaal zum Blank- oder Silberaal. Der Rücken wird dunkler und der Bauch silbrig weiß. Der Kopf spitzt sich zu und...
Wenn die innere Uhr des Aals ihn zurück in sein Geburtsgewässer zieht, dann beginnt die nächste Metamorphose. Er wird vom Gelbaal zum Blank- oder Silberaal. Der Rücken wird dunkler und der Bauch silbrig weiß. Der Kopf spitzt sich zu und die Augen verdoppeln sich im Durchmesser, damit er später in der Tiefsee auch richtig sehen kann. Auch die Brustflossen vergrößern sich. Der Verdauungstrakt dagegen bildet sich zurück. Nun entwickeln sich auch die Geschlechtsorgane. Im Körpergewebe verändert sich auch der Gehalt an Salz, Wasser und vor allem Fett.
Der lange Weg zurück in die Sargassosee dauert bis zu drei Jahren. Es wird vermutet, dass die Tiere in dieser Zeit nichts mehr oder nur noch sehr wenig fressen. Viele Tiere schaffen jedoch nicht einmal den Weg ins offene Meer.
Ergebnisse, die per Satellitentelemetrie an Aalen gewonnen wurden, zeigten, dass die Tiere sich während der Wanderung tagsüber in kühlen Wässern zwischen 200 und 1.000 Metern Tiefe aufhalten und nachts in wärmeren Oberflächenbereichen schwimmen.
Nach der Eiablage sterben die Aale – vermutlich an Erschöpfung.

Es ist 5 vor 12 – der Aal in Gefahr
In den letzten Jahren erreichen immer weniger Glasaale die europäischen Küsten. Der Aalbestand ist zwischen 1980 und 1999 um 95 – 99% zurückgegangen. Dies hat ganz unterschiedliche Ursachen: Da sich der Aal nur einmal in seinem Leben vermehrt, fehlt jeder Aal, der – aus welchen Gründen auch immer – vorher stirbt, bei der Reproduktion. Ganz natürliche Verlustraten werden, wie bei anderen Fischen auch, durch die hohe Zahl der Nachkommen ausgeglichen. Inzwischen machen dem Aal aber immer mehr Gefahren zu schaffen, die wir Menschen zu verantworten haben.
Entnahme von Glasaalen

Viel zu viel Glasaale landen heutzutage auf den Tellern von Feinschmeckern. Für 1 kg Aal werden rund 3.000 Tiere gefangen. Besonders groß ist der asiatische Markt. Aber auch in Spanien und Frankreich gibt es reichlich Liebhaber dieser fragwürdigen Delikatesse. Die Preise sind immens. 1 kg Glasaal kann bis zu 1.000 € kosten. Da die Tiere auf der "Roten Liste" stehen und eigentlich für den Verzehr gar nicht mehr gefangen werden dürfen, hat sich ein Schwarzmarkt entwickelt, der weiterhin die schon stark dezimierte Population schwächt.
Glasaale werden aber auch für den Besatz von Gewässern entnommen, in die der Aal nicht mehr einwandern kann. Mit dieser Maßnahme unterstützen die Fischer und Angler allerdings die Erhaltung des historischen Verbreitungsgebietes der Aale, weil diese durch Verbau und Trockenlegungen zu vielen Seen nicht mehr in angemessener Zahl gelangen oder gar nicht dort ankommen. Auch die Aale in Aquakulturen entstammen allesamt dem natürlichen Bestand der Glasaale, da sich Aale nicht in Gefangenschaft vermehren lassen.
Kraftwerke, Staustufen, Flussbegradigungen
Durch Kraftwerksanlagen kann eine natürliche Zuwanderung z. B. über den Rhein praktisch nicht mehr erfolgen. Zudem werden abwandernde Aale durch die Turbinen der Kraftwerke in erheblichem Umfang tödlich verletzt.
Zudem blockieren Staustufen die Aalwanderung in den Flüssen. Flussaufwärts wird der Weg des Aals meist durch Besatzmaßnahmen abgekürzt. Auf der Laichwanderung jedoch machen oft Wehre das Weiterkommen der Blankaale unmöglich. Der alternative Weg führt dann meist nur durch die Schaufeln einer Turbine. Turbinenschaufeln brechen ihnen das Rückgrat oder hacken sie in Stücke.
Der Main z. B. hat auf 300 km Flusslänge 27 Staustufen. An anderen Flüssen ist es ähnlich. Von 100 Blankaalen, die in der Nähe Stuttgarts ihre Laichwanderung beginnen, erreichen 99 nicht das Meer, berichtete Dr. Rainer Berg aus Langenargen in einem Vortrag. Aber auch bei anderen Kraftwerken, gleich welchen Typs, können Fische mit dem Kühlwasser angesaugt werden. Experten vermuten, dass weit mehr Aale durch Turbinen vernichtet als durch die Fischerei entnommen werden.
Im letzten Jahrhundert wurden sehr viele Flüsse begradigt, Seeufer bebaut und betoniert. Dies alles hat Einfluss auf die Lebensqualität der Tiere. Begradigte Flüsse fließen schneller, es fehlt an Verstecken und oft an typischen Pflanzen.
Umweltverschmutzung
Aale gehören zu den Fettfischen. Bis zu 30 % ihres Körpergewichtes macht die Fettmasse aus. In diesem Fett reichern sich besonders Schwermetalle an, aber auch erhöhte Werte an Pestiziden konnten nachgewiesen werden. Aale überleben auch in sehr stark verschmutzten Gewässern, weil sie von geradezu beängstigender Zähigkeit und Überlebensfähigkeit sind. Unter den Schadstoffen sind leider auch viele mutagene (erbschädigende) Stoffe. Diese werden beim Umbau des Körpers und während der Reise frei und vergiften den Aal förmlich. Eine Folge davon: Die Fruchtbarkeit sinkt drastisch, weil Eier und Spermien geschädigt sind.
Unsere Flüsse sind zwar inzwischen immer sauberer geworden, doch reichern sich die Schadstoffe über die Nahrungskette weiterhin im Fisch an, weil sie ja nicht vollständig verschwunden sind. Da die Tiere sehr alt werden, können auch kleine Dosen Gift - über lange Zeit aufgenommen - negative Folgen haben.
Überfischung
Aale sind wegen ihrer Größe und ihres Geschmacks beliebte Speisefische und besonders gefährdet für Überfischung. Weil die Tiere erst spät geschlechtsreif werden und sich am Ende ihres langen Lebens nur einmal fortpflanzen, kann sich der Bestand nur langsam erholen. Aufgrund ihrer langen und gefährlichen Wanderwege sterben viele bereits vor der Paarung. Unkontrollierte Beifänge von Aal reduzieren die Bestände zusätzlich.
In China, Taiwan, Korea und Malaysia wurden und werden riesige Aalfarmen gebaut, die unter anderem für den japanischen Markt produzieren. Jedoch müssen auch hierfür Aale aus dem natürlichen Bestand entnommen werden. Für die Kapazität der riesigen Farmen reicht das Aufkommen des Japanischen Aals (anguilla japonica) bei weitem nicht aus. So hat man den europäischen Aal "entdeckt". In der Saison 1996 z. B. wurden vermutlich 200 bis 300 Tonnen Aalbrut nach China verkauft. Das ist etwa die Hälfte der für Besatz verfügbaren Glasaale.
Die Beratungsgruppe EIFAC/FAO schätzt, dass bereits lange vor dem Eintreffen der ersten 97er Glasaale am Atlantik Bestellungen aus China über 250 Tonnen Aalbrut vorlagen, wobei China dafür bis zum Dreifachen des europäischen Marktpreises geboten haben soll. Derzeit werden sogar Preise von über 1.000 €/kg Glasaal geboten. Nach Schätzungen verbrauchen die Japaner mindestens 100.000 Tonnen Aale im Jahr, die Europäer zusammen etwa 25.000 Tonnen. Praktisch der gesamte Aalbestand der Rheinzuflüsse beruht auf Besatzmaßnahmen.
